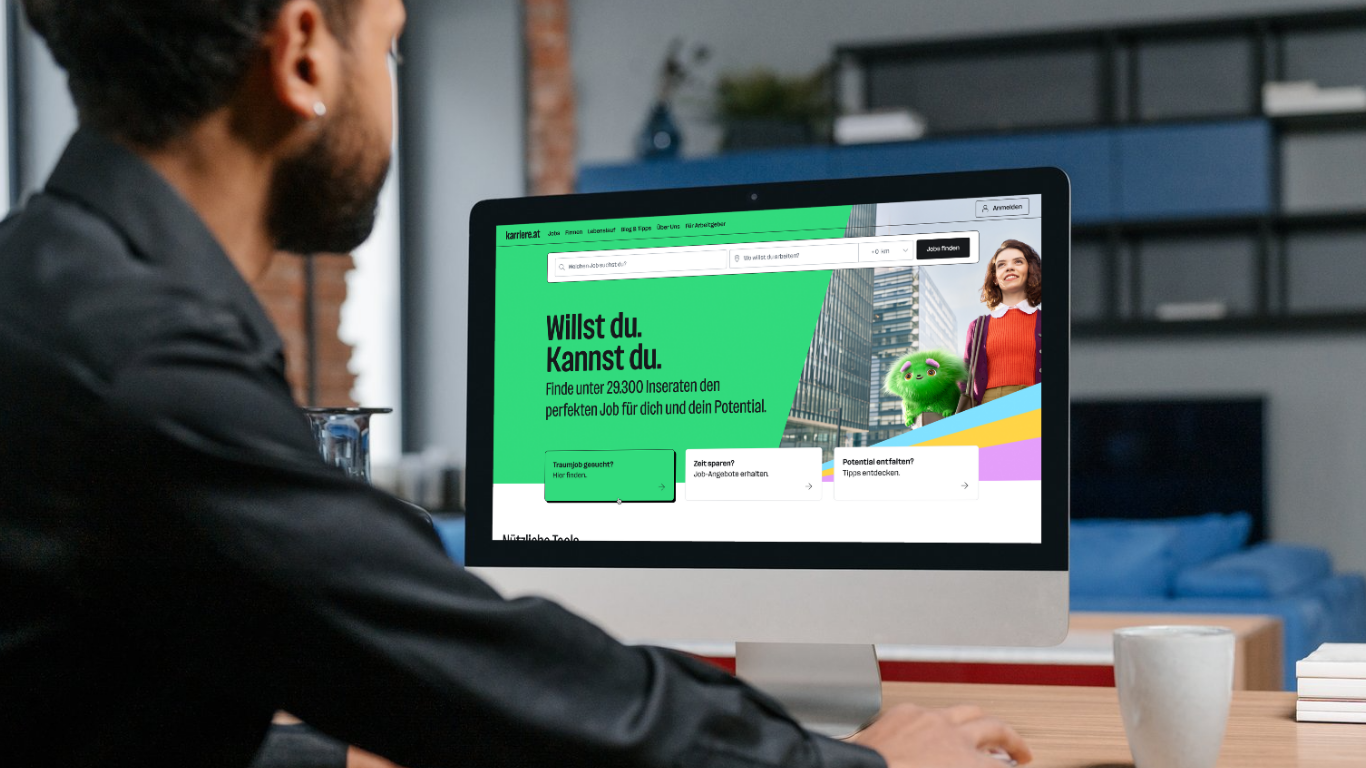Sprache und Dialekt auf der Spur – was macht eigentlich ein Sprachforscher?
Tschinallen, hackeln, malochen … arbeiten kann man im Dialekt sehr vielseitig und genau damit beschäftigt sich der Sprachforscher Stephan Gaisbauer. Er arbeitet im Linzer Stifter-Institut und erforscht und dokumentiert alles rund um sprachliche Phänomene in Oberösterreich. Wir haben bei ihm nachgeforscht, wie der Beruf der Sprachforscher*in aussieht.
Was macht eine Sprachforscher*in? #

Stephan Gaisbauer
Gaisbauer: Mein Ausgangspunkt ist dialektologisch. Wir wollen die Unterschiede in den verschiedenen Regionalsprachen und Dialekten durch Erhebungen vor Ort feststellen und dokumentieren. Da fährt man in viele Gemeinden in Oberösterreich und macht Tonaufnahmen mit Gewährspersonen oder auch schriftliche Erhebungen. Das ist ein Teil der Arbeit eines Sprachforschers, der andere Teil ist der, dass man das Ganze analysiert und kartiert in Sprachkarten oder dem Höratlas mit online-Tonaufnahmen. Neben dem Schwerpunkt in Oberösterreich haben wir aber auch Erhebungen in Südböhmen bei den wenigen verbliebenen Deutschen gemacht oder auch in Rumänien, Siebenbürgen, in der Ukraine, im Banat, wo wir Deutsch als Minderheitensprache in Osteuropa untersucht haben.
Derzeit arbeite ich an einer größeren Erhebung zur Mehrsprachigkeit, die jeder in sich hat – da geht es nicht unbedingt um Fremdsprachen, sondern auch um das Wechseln zwischen Dialekt und Standardsprache. Da schaut man sich an, in welchen Situationen jemand wie spricht, wie sich Leute an Gesprächspartner anpassen, wenn z.B. am Telefon jemand mit einem Gesprächspartner aus Deutschland schönstes Standarddeutsch spricht etc.
Aber auch die heutige Jugendsprache schauen wir uns an, wir machen kulturwissenschaftliche Publikationen, wo Erhebungen in verschiedenen Gegenden gemacht werden. Dazu ist beispielsweise im Oberen Mühlviertel in Zusammenarbeit mit Musikwissenschaftlern, Literaturwissenschaftlern, Volkskunde-Kennern etc. der Band „Grenzgang“ entstanden.
„Ich habe mich lange mit freien Dienstverträgen dahingewurschtelt – das war aber trotzdem eine schöne Zeit mit vielen Freiheiten.“
Ausbildung #
Wie sind Sie zu Ihrem Beruf gekommen?
Gaisbauer: Nach der Schule habe ich auf Lehramt Deutsch und Griechisch studiert. In einer Veranstaltung an der Universität wurden Leute zur Feldarbeit ins Weinviertel geschickt für Sprachaufnahmen mit älteren Leuten. Der Sprachatlas wurde als Projekt im StifterHaus Linz geführt, bei dem ich und zwei andere dann Aufnahmen machen durften. Mit Fragebögen bewaffnet waren wir unter anderem vier Tage in einer Gemeinde und befragten Leute aus der älteren Generation und haben das mit Lautschrift niedergeschrieben. Und schließlich bin ich dann im StifterHaus geblieben. Das war vorerst nur neben dem Studium und dann habe ich mich zwölf Jahre lang mit Werkverträgen, freien Dienstverträgen „dahingewurschtelt“. Das war aber trotzdem eine schöne Zeit mit vielen Freiheiten. Nebenbei hatte ich dann eine halbe Anstellung, machte aber noch vieles selbstständig. Nach 20 Jahren konnte ich mich dann von der gewerblichen Sozialversicherung abmelden.
Gibt es einen klassischen Ausbildungsweg dorthin?
Gaisbauer: Es gibt zwar viele Leute, die das Thema Sprache interessiert und die da mitreden können, aber es geht eigentlich nur über eine universitäre Ausbildung und man sollte schon wissenschaftlich arbeiten können. Das Problem ist auch, dass es sonst gerne passiert, dass man volksetymologisch interpretiert und vieles ohne wissenschaftlichen Hintergrund erklären möchte – v.a. bei Namen. Man muss schon sprachhistorisch geschult sein, man muss wissen, wie sich die Standardsprache und Dialekte entwickelt haben und sollte auch Mittelhochdeutsch und idealerweise andere indogermanische Sprachen verstehen. Idealtypische Studien dafür wären Germanistik oder Linguistik, wo man auch lernt, wie man Studien plant und was man dazu braucht. Mit anderen romanistischen Fächern kann man das aber sicher ebenfalls bewältigen.
Arbeitsalltag #
Wie schaut ein typischer Arbeitstag bei Ihnen aus?
Gaisbauer: Innerhalb des Instituts habe ich eine relativ große Freiheit in dem, was ich machen möchte. Durchschnittlich bin ich ein, zwei Mal in der Woche oberösterreichweit unterwegs auf Feldforschung. Dabei komme ich natürlich mit relativ vielen Menschen in Kontakt. Wir haben für die Erhebungen circa 2000 Gewährspersonen, die wir ursprünglich über die Gemeinden und Gemeindebedienstete gefunden haben.
„Viele haben von zu Hause mitbekommen, dass sie nicht ,gschertʽ reden sollen.“
Stimmt es, dass der Dialekt am Aussterben ist?
Gaisbauer: Einige Leute waren da zuerst etwas voreingenommen, weil man ja oftmals in der Erziehung mitbekommen hat, dass man nicht „gschert“ reden soll. Mittlerweile ist Dialekt aber sehr gesellschaftsfähig geworden. In OÖ ist das fast schon etwas bedenklich – da hat es von den Soziologen der Universität Linz eine Studie gegeben, dass viele Lehrende im Unterricht im Dialekt sprechen und nicht verstanden werden würden. OÖ ist sicher ein dialektfreundliches Land.
Handelt es sich bei der Sprachforscher*in um einen Nischenberuf?
Gaisbauer: An den Universitäten, die Kulturwissenschaften haben, gibt es immer wieder Linguistikinstitute – in Wien, Salzburg, Graz, Innsbruck und Klagenfurt. Dort gibt es eine Handvoll Linguisten im engeren Sinn und an den Germanistikfachbereichen vereinzelt. Als sozusagen ausgelagerte Institution für Sprachforschung sind wir im StifterHaus ein Exoticum, ich und eine freie Mitarbeiterin. Das Land OÖ leistet sich das, weil man viel für Kultur ausgibt und für Linz keine universitäre Institution dafür besteht. Damit verfolgt man allerdings nicht nur wissenschaftliche Ziele, sondern auch bildungspolitische – irgendwann soll das auch didaktisch in der Schule eingesetzt werden und es soll so populärwissenschaftlich aufbereitet werden, dass sich viele Leute dafür interessieren. Tatsächlich kann man seit dem Jahr 2000 von einem richtigen wissenschaftlichen Aufschwung im Bereich der Dialektologie sprechen, das wird auch gefördert durch Projekte und viele Universitätsstellen.
Wie schaut der Arbeitsmarkt dafür aus, wenn man daran interessiert ist?
Gaisbauer: Außerhalb von Universitäten sind die Zugänge da äußerst rar. Meist muss man sich bei heutigen Universitätskarrieren entweder für Familie oder Karriere entscheiden und muss zudem sehr ambitioniert und lokal sehr flexibel sein. Aber an und für sich gibt es momentan schon relativ viele Möglichkeiten – seit zwanzig Jahren war die Situation für Sprachforscher nicht so günstig wie jetzt gerade.
Aufgabenfelder & Gehalt #
Was sind die besonders spannenden und interessanten Seiten an Ihrem Beruf? Gibt es auch lästige oder unangenehme Seiten?
Gaisbauer: Grundsätzlich ist fast alles spannend! Ich hatte eigentlich noch nie einen Tag, an dem ich nicht gerne in die Arbeit gegangen wäre. Die Verknüpfung von Begegnungen mit Menschen und theoretischer Arbeit – also Forschung und Praxis.
Was etwas nervig ist, sind vielleicht die unglaublichen Mengen an Daten, die da zusammenkommen und die man ja auch irgendwie managen muss. Entscheidungen sind immer sehr folgenschwer – wenn wir jetzt entscheiden, dass 100 Leute mehr befragt werden, dann wirkt sich das enorm aus. Man hat einfach wahnsinnig viel Arbeit mit dem Material. Und dieses muss auch doppelt gesichert sein, weil es sehr labil ist. Je digitaler das wird, umso heikler wird das. Da hängen tatsächlich tausende Stunden von Arbeit an einer Entscheidung, die man trifft.
Sind Sie mit der Entlohnung zufrieden?
Gaisbauer: Ich kann nicht klagen. Für mich ist das aber auch nicht so im Zentrum, mir ist es wichtiger, dass ich das machen kann, was mich interessiert. Aus der Kenntnis der vielen unbezahlten Praktika kann man es nicht unbedingt empfehlen, aber wenn man sich wirklich dafür interessiert, findet man irgendeinen Weg, das auch tatsächlich als Brotjob zu machen. Man kann das ja auch als Lehramt studieren, so habe ich es gemacht, dann könnte man notfalls noch unterrichten.
Was sollte man für diesen Beruf mitbringen?
Gaisbauer: Man braucht in erster Linie einen guten Draht zu den Menschen für die Feldforschung – Liebe zu den Leuten. Man muss auch einschätzen können, inwiefern das alles stimmt, was einem die Leute so erzählen. Auch ein phonetisches Gehör ist von Vorteil, weil man verschiedene Laute ja auch gut unterscheiden können muss. Was man am PC so braucht, kann man sich auch praktisch aneignen. Den Umgang mit Datenbanken und Audioprogrammen muss man erst lernen.
„Den Steirer und den Engländer verbindet die Aussprache, trennt aber das Prestige.“
Ist es so, dass sich die Menschen besonders zusammenreißen, wenn Sie vor Ihnen sprechen?
Gaisbauer: Nein. Man hat den Fuß in der Tür, wenn man mit der Dialektmasche kommt. Das interessiert die Leute, das ist interessant für sie. Das ist irgendwie witzig, weil man das in meiner Schulzeit immer versuchte sich abzugewöhnen. Viele Oberösterreicher sind dazu aber auch nicht bereit oder machen das unbewusst, dass sie sich z.B. in Wien sprachlich nicht anpassen. Das sind immer prestigegeleitete Phänomene, denn es ist ja nicht der Dialekt schön oder unschön. Wenn der Steirer sagt „wou“ dann klingt das irgendwie hinterwäldlerisch und wenn der Engländer sagt „sou“, dann hat das was Gehobenes.
„Der Dialekt wird nicht verschwinden, die Sprache verändert sich nur, wie es das Deutsche seit dem achten Jahrhundert tut.“
Dialektsterben gibt es in der Literatur schon lange – seit dem 17. Jahrhundert ist es dokumentiert. Es gibt sicher Gegenden in Österreich, z.B. Wien, Graz und Salzburg, wo man Kinder eher nicht mehr im Dialekt sozialisiert. In OÖ kann man auf jeden Fall nicht vom Dialektsterben sprechen. Natürlich gibt es immer wieder Veränderungen, sonst würden wir heute immer noch Althochdeutsch sprechen. Lokaldialekte lösen sich schon zunehmend auf. Es spricht ja alles dafür, dass die globale Welt den Menschen irgendwie zu groß ist und dass sie sich in kleineren Kommunikationsräumen immer wieder formieren, sodass immer wieder neue Varietäten entstehen. Zu einem einheitlichen Standarddeutsch gibt es an und für sich keine Tendenzen. Die Vielfalt an Dialekten hat natürlich schon eine gewisse Qualität und würde es die nicht geben, wäre meine Existenz natürlich auch bedroht.
Dialektworte rund um den Begriff „Arbeit“ #
| Dialektwort | Bedeutung |
| barabern | ‘Erdarbeiten machen, schwer arbeiten, Hilfsarbeiten verrichtenʼ < it. barabba ‘Landstreicher, Taugenichtsʼ; um 1900 beim Straßen- und Eisenbahnbau aufgekommen, nicht pejorativ („I geh barabern.“) |
| butteln | ‘stark und viel arbeitenʼ; ursprgl. von Bräuarbeitern, die Eis oder Malz in Butten herbeischaffen mussten |
| hackeln | ‘manuell (schwer) arbeitenʼ; Iterativbildung zu håcken ‘mit einer Hacke, einem Werkzeug arbeitenʼ |
| kretschen | ‘übermäßig viel und anstrengend arbeitenʼ |
| niederreißen | ‘hastig, stark arbeitenʼ („Der NN reißt alles nieder.“) |
| Tschinäller | 1. ‘ungelernter Arbeiterʼ, 2. ‘Arbeiter, der schwere Arbeiten verrichtetʼ, 3. ‘fleißiger Arbeiterʼ |
| rackern | (abhin-, zusammen-) ‘schwer arbeitenʼ < mhd. recken ‘ausstreckenʼ |
| sich schinden | ‘sich plagen, schwer arbeitenʼ < mhd. schinden, schinten ‘häuten, schälenʼ |
| tschechern | ‘sich abmühen, hart arbeitenʼ < jidd. schochar ‘trinken, sich berauschenʼ |
| tschinällen | 1. ‘schwere körperliche Arbeiten verrichtenʼ, 2. ‘fleißig arbeitenʼ < ung. csinál ‘machen, tunʼ |
| webern | ‘emsig, geschäftig seinʼ |
| Håcken | ‘(ursprgl. schwere) berufliche Arbeitʼ < mhd. hacke ‘Axt, Beilʼ |
| Hackler | 1. ‘Arbeiterʼ, 2. ‘Pensionist im Sinne der Hacklerregelungʼ |
| Tschåch | ‘große Mühe, Anstrengung; schwere Arbeitʼ |
| Wasserbüffel | ‘schwer und viel arbeitender Menschʼ („Der NN arbeit wie ein W.“) |
Zur Person #
Stephan Gaisbauer (geb. 1967 in Vöcklabruck) studierte nach der Matura am Linzer Gymnasium Petrinum Deutsche und Klassische Philologie sowie Kirchenmusik in Wien. Bereits während des Studiums unternahm er zahlreiche Feldforschungen zu den oberösterreichischen Dialekten und zu den deutschen Sprachvarietäten in Mittel-, Ost- und Südosteuropa. Seit 2006 ist er als Sprachwissenschaftler am Adalbert-Stifter-Institut des Landes Oberösterreich beschäftigt, wo er unter anderem den „Sprachatlas von Oberösterreich“ herausgibt.
Bildnachweis: jcjgphotography/Shutterstock; Franz Linschinger / Land OÖ; Brian A Jackson / Shutterstock